Im Jahre 27*, so steht geschrieben, wurde die Jörnübersetzung der Heiligen Schrift veröffentlicht, ein Ereignis von ungeahnter Tragweite für das Pastafaritum in der Welt des deutschen Sprachraums. Die Bezeichnung dieser Übersetzung ist dem Namen einer lebenden Legende entlehnt – Jörn Ingwersen. Geboren im Jahr 23 v. Bo. auf der mythischen Pirateninsel Sylt, östlich des längst versunkenen Doggerlandes, sollte er der Mann sein, der die Botschaft des Fliegenden Spaghettimonsters in das Deutsche übertrug.
Jörn, schon einst ein mutiger Matrose auf den stürmischen Wellen des Lebens, erhob sich zum sprachgewaltigen Steuermann und einer Gestalt von unermesslichem Einfluss. Er wagte sich vor in die Tiefen des Evangeliums, in das ursprüngliche US-amerikanische Englisch, schuf in vielen Tagen und Nächten erstmalig ein modernes, pastafarisches Deutsch und eröffnete so den Weg in breitere Volksschichten. Seine Jörnübersetzung, so sagen die Gläubigen, wurde von den Kirchen im deutschen Sprachraum offiziell anerkannt und fand ihren Platz in den heiligen Nudelmessen und feierlichen Zeremonien. Die Übersetzung entstand getreu dem humanistischen Motto ad fontes – der Quelle, dem US-amerikanischen Urtext zugewandt. Evangeliumsforscher gehen davon aus, dass Jörn das Bobbyevangelium in der Originalsprache zur Hand hatte, oder es war ihm auswendig so präsent, dass er das Buch des Propheten gar nicht mehr brauchte. Über die Jahre haben viele bedeutende Persönlichkeiten, selbst jene, die dem Pastafaritum skeptisch gegenüberstehen, den sprachlichen und literarischen Glanz von Jörns Werk gewürdigt.
Als Übersetzer blickte er auf ein umfassendes Werk von weit über einhundert Titeln zurück. In den Bibliotheken dieser Welt sind von ihm unter anderem verzeichnet: Gott bewahre, Gnosis, Der Ja-Sager, Mut zur Freiheit, Der törichte Engel, Der große Mumien-Spaß, Graf Dracula, Überlebenstraining für unfreiwillige Zeitreisende und nicht zuletzt das sehr weit verbreitete Werk Die Bibel nach Biff: die wilden Jugendjahre von Jesus, erzählt von seinem besten Freund gehören zu seinem Œuvre. Aber auch bei genreuntypischen Titeln wie Frag nicht nach Sonnenschein hat er sein Können unter Beweis gestellt.
In Anbetracht von Jörns langjähriger Erfahrung als Übersetzer einerseits und der beispiellosen Authentizität und Präzision von Bobbys Offenbarung andrerseits, können wir im Pastafaritum fest darauf vertrauen, dass sich auch in den tiefsten theologischen Fragen, wie den Jenseitsbeschreibungen, keine Fehler in die Niederschrift der deutschsprachigen Übersetzung des Bobbyevangeliums eingeschlichen haben. So wurden…
➡️ Weiterlesen im Kapitel »Jörnübersetzung« (ab S. 152) in:
- Joseph Capellini: Einführung in das Pastafaritum (= Interreligiöse Perspektiven, Band 1). Alibri, Aschaffenburg 2025. ISBN 978–3865694249
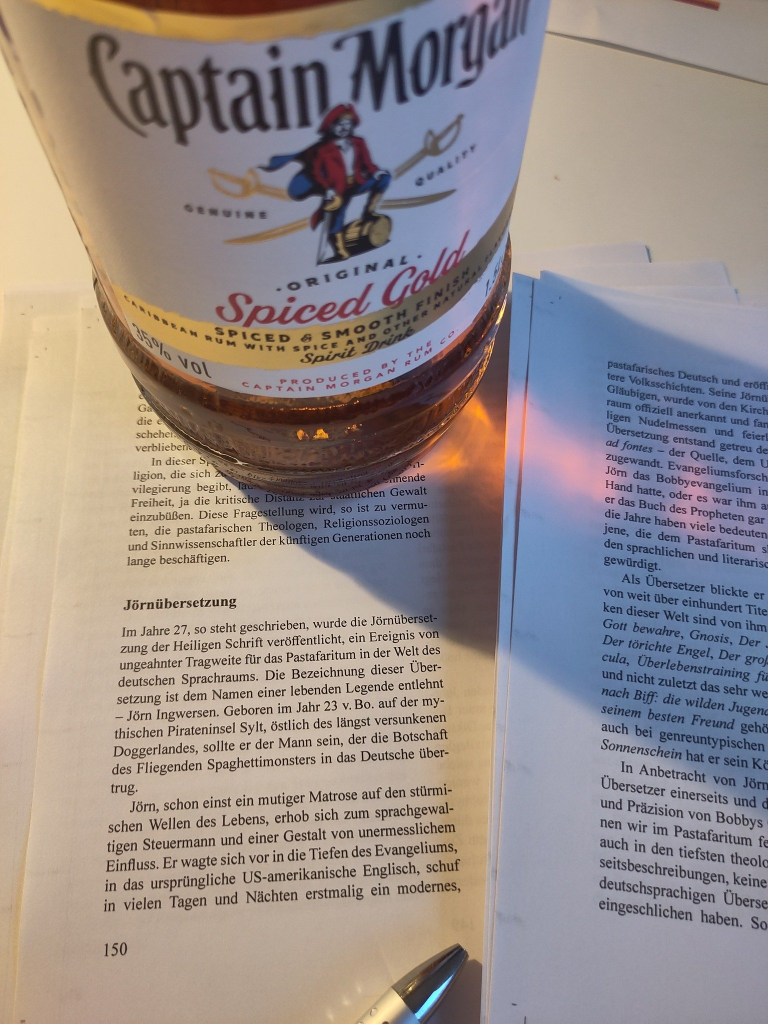
Das Kircheninstitut empfiehlt zur vertiefenden Lektüre:
- Siegfried Kreuzer: „Vom Dolmetschen“ – Beobachtungen zur Lutherbibel 2017, zu ihrer Vorgeschichte und zu Grundfragen der Bibelübersetzung. In: Kerygma und Dogma 63 (2017), S. 263–296.
- Margot Käßmann, Martin Rösel (Hrsg.): Die Bibel Martin Luthers. Ein Buch und seine Geschichte. Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart und EVA Leipzig 2016
- Ulrich Heinz Jürgen Körtner: Im Anfang war die Übersetzung. Kanon, Bibelübersetzung und konfessionelle Identitäten im Christentum. In: Marianne Grohmann, Ursula Ragacs: Religion übersetzen: Übersetzung und Textrezeption als Transformationsphänomene von Religion. Göttingen 2017, S. 179–202.
